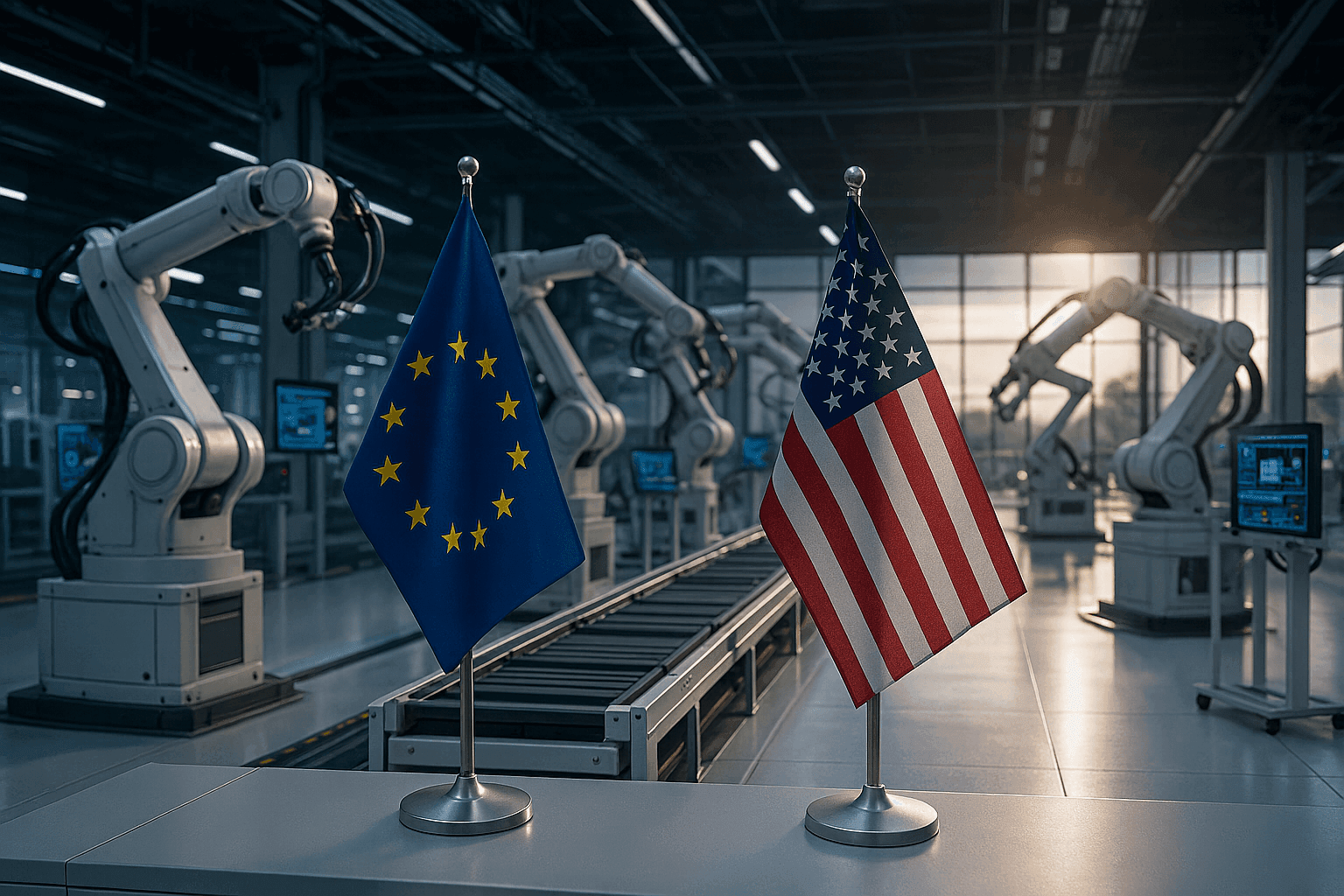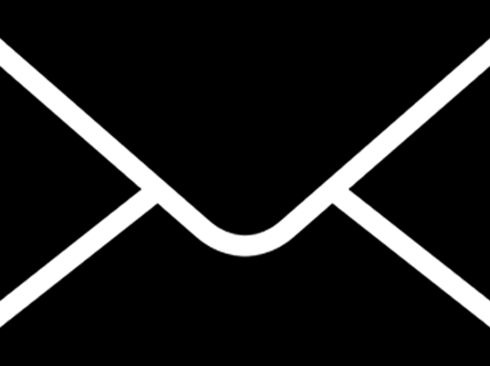Ein Weckruf für den deutschen Maschinenbau: Was das neue EU-US-Handelsabkommen wirklich bedeutet
Der 15%-Zoll hat zwar einen Handelskrieg abgewendet, etabliert jedoch ein neues Kostenregime für Europas Industrieexporteure. Vom Mittelstands-OEM bis zu den osteuropäischen Zulieferern ist die Notwendigkeit, zu lokalisieren, umzustrukturieren und intelligenter zu planen, dringlicher denn je.
Vom Zoll-Drohung zum strategischen Wendepunkt
Ein neues Kapitel im EU-US-Handel beginnt am Donnerstag, den 7. August 2025. Das kürzlich am 27. Juli unterzeichnete Abkommen markiert eine Veränderung, die deutsche Industrieexporteure nicht ignorieren können. Ein Kompromiss in letzter Minute verhinderte einen drohenden Handelskrieg, indem er einen US-Importzoll von 15 % auf nahezu alle EU-Industriegüter einführte – eine deutliche Verbesserung gegenüber den zuvor angedrohten 30 %.
Für die deutschen Hersteller von Maschinen und Industrieanlagen, das exportgetriebene Rückgrat der europäischen Wirtschaft, sind die Auswirkungen jedoch komplex. Als Partner bei H&Z und langjähriger Berater dieses Sektors möchte ich eine nüchterne, aber zukunftsorientierte Analyse bieten.
1. Exporte unter Druck, aber weiterhin in Bewegung
Die unmittelbare Auswirkung des 15%-Zolls ist klar: Deutsche Maschinen werden auf dem US-Markt teurer. Die USA sind seit langem der wichtigste außereuropäische Exportmarkt für viele mittelständische und große deutsche Hersteller, mit Exporten von über 35 Milliarden Euro allein im Jahr 2023.
Mit dem zusätzlichen 15%-Zoll müssen Unternehmen nun entscheiden:
- Kosten an US-Kunden weitergeben und Wettbewerbsfähigkeit riskieren?
- Oder die Kosten selbst tragen und Margenbelastungen in Kauf nehmen?
Keine der Optionen ist ideal, besonders für spezialisierte mittelständische Unternehmen, die bereits globalem Preisdruck ausgesetzt sind. Die Margen werden schrumpfen, und einige Investitionen könnten pausiert oder gestrichen werden.
Dennoch wurde ein tieferer Schlag vermieden. Die ursprünglich angedrohten 30 % Zoll wären katastrophal gewesen. Insofern stellt dieses Abkommen Schadensbegrenzung dar – schmerzhaft, aber überlebbar.
2. Vom Trend zur Notwendigkeit: „Local-for-Local“ wird zentral
Der 15%-Zoll hat eine klare Konsequenz: Lokale Produktion in den USA wird zur strategischen Notwendigkeit.
Der „Local-for-Local“-Ansatz – also Produktion dort, wo verkauft wird – hat sich in den letzten Jahren beschleunigt, getrieben von geopolitischer Unsicherheit und Reshoring-Trends. Er wird nun essenziell, insbesondere für Unternehmen, die bei öffentlichen Ausschreibungen mit „Buy American“-Vorgaben wettbewerbsfähig bleiben wollen.
Viele deutsche Firmen haben bereits in Bundesstaaten wie Texas, South Carolina oder Michigan investiert und sind dadurch im Vorteil:
- Sie umgehen Importzölle.
- Sie qualifizieren sich als inländische Lieferanten.
- Sie erhalten schnelleren Zugang zu lokalen Kunden.
Andere müssen nun aufholen. Das erfordert mehr als Kapital – es braucht strategische Klarheit, operative Agilität und regulatorisches Verständnis. Bei H&Z unterstützen wir viele Kunden aktuell dabei, ihre globale Standortstrategie neu zu denken.
3. Details der Zölle sind entscheidend: Nicht alle Maschinen sind gleich
Ein oft unterschätztes Detail des Abkommens ist, dass bestimmte Sektoren und Produktgruppen zollfrei bleiben, darunter Ausrüstungen für die Halbleiterfertigung und ausgewählte Automatisierungstechnologien.
Das eröffnet echten Spielraum für einige Unternehmen. Wenn deine Ausrüstung unter eine dieser Ausnahmen fällt oder modular geliefert werden kann, um die Zollbelastung zu reduzieren, kann der Unterschied erheblich sein.
Hier treffen technische Details auf strategische Handelsplanung. Jetzt ist die Zeit, Zolltarifnummern (HS-Codes), Produktportfolios und Lieferketten nicht nur strategisch, sondern im Detail zu überprüfen.
4. Osteuropäische Zulieferer: Zwischen den Fronten
Die neue Realität betrifft nicht nur direkte Exporteure. Osteuropäische Zulieferer, insbesondere in der Slowakei, Tschechien und Rumänien, sind indirekt gefährdet.
Viele deutsche Maschinenbauer haben lange auf kostengünstige, qualitativ hochwertige Fertigungskapazitäten in Osteuropa gesetzt. Typischerweise werden Teile in Brünn oder Košice gefertigt, die Endmontage erfolgt in Bayern, dann erfolgt der Export in die USA.
Jede zusätzliche Grenze in der Lieferkette kann nun Zollkosten verursachen. Komplexe, grenzüberschreitende Produktionsflüsse, einst ein Effizienzvorteil, werden zu Kostenfallen.
Das könnte Nearshoring nach Deutschland beschleunigen oder direkte Investitionen in Nordamerika fördern. Osteuropäische Werke könnten Auftragsrückgänge erleben, sofern sie nicht näher an den Endkunden rücken.
5. Buy American trifft EU-Verpflichtungen: Ein riskanter Kompromiss
Das Abkommen umfasst mehr als nur Zölle. Die EU hat sich zu massiven US-Importen verpflichtet, darunter 250 Milliarden US-Dollar an Energie wie LNG, Öl und Uran sowie eine nicht näher bezifferte Menge an Militärausrüstung.
Das mildert zwar die Zollbelastung ab, bedeutet aber auch, dass europäische Lieferanten in strategischen Sektoren Marktanteile verlieren. Von Verteidigungsunternehmen bis zu Energietechnikfirmen werden viele nicht wegen des Preises, sondern aus politischen Gründen ausgeschlossen.
Schlimmer noch: Die USA behalten sich das Recht vor, höhere Zölle wieder einzuführen, falls die EU ihre Kaufverpflichtungen nicht erfüllt. Für Industrieexporteure ist das eine tickende Zeitbombe.
Die Botschaft: Handelsrisiken durch Politik sind dauerhaft. Unternehmen müssen Geopolitik direkt in ihre Wachstums- und Regionalstrategien einbeziehen.
6. Ein Sektor in Bewegung und Wandel
Trotz aller Herausforderungen sehen wir auch echte Chancen für proaktive Unternehmen.
Wer US-Produktion, starke lokale Partnerschaften oder flexible Lieferketten hat, ist besser positioniert denn je. Ihre Produkte bleiben wettbewerbsfähig, Lieferzeiten kürzer, und sie erfüllen die „lokale Beschaffung“-Anforderungen vieler US-Kunden.
Das Handelsabkommen könnte sogar breitere Trends wie Regionalisierung, Automatisierung und Diversifizierung der Lieferketten beschleunigen – Entwicklungen, die H&Z seit Jahren genau verfolgt.
Wir sind überzeugt: Deutscher Maschinenbau bleibt ein globaler Maßstab. Doch heute reicht Qualität allein nicht mehr. Sie muss unter neuen Ursprungsregeln, politischer Kontrolle und Kostendruck erbracht werden.
Abschließende Gedanken: Ein Weckruf
Das EU-US-Handelsabkommen 2025 ist keine Katastrophe, aber ein klares Signal, dass die goldene Ära des freien transatlantischen Handels vorbei ist.
Deutsche Maschinenbauer müssen jetzt schnell umsteuern:
- US-Marktstrategien überdenken
- Zollklassifikationen prüfen
- Lieferketten neu ausbalancieren
- Lokale Kapazitäten reinvestieren
Für H&Z ist das mehr als eine Herausforderung – es ist ein Wendepunkt.
Ja, Zölle schmerzen. Aber sie schaffen auch Klarheit. Sie trennen Reaktive von Proaktiven.
Wer jetzt klug, schnell und strategisch handelt, kann diesen Gegenwind in einen langfristigen Wettbewerbsvorteil verwandeln.
Unsere Rolle als Berater ist es, dich bei dieser Transformation zu unterstützen – nicht nur, um Veränderungen zu bewältigen, sondern um sie zu gestalten.
Lass uns loslegen.